Vor dem Aufschwung kommt der Fall - Die Dänen rücken an
- © Simone Gütte

- 9. Nov. 2025
- 3 Min. Lesezeit


Grafiken erstellt von © Simone Gütte mit Hilfe von canva.com
Nicht nur Sturmfluten suchten mein Eiland über die Jahrhunderte immer wieder heim, auch geächtete Piraten, wundersame Fischschwärme und gierige Herrschaften.
Ein wenig möchte ich ausholen:
Slongs ʼet Lun stunt - So lange die Insel steht, nagen Wind und Wellen an ihren Klippen. 1219 und 1362 waren es die Marcellusfluten, die die Insel überschwemmten und tausende Menschen in den Tod rissen. Um 1401 ließen sich die Halunder in die Kämpfe um den Seeräuber und Likedeeler Klaus Störtebeker verwickeln. Die Piraten wurden von der Kogge Bunte Kuh auf See gestellt und nach Hamburg verbracht, wo Störtebeker und seine Spießgesellen auf dem Grasbrook ihr legendäres, kopfloses Ende fanden.
Als 1425 der segensreiche Hering rund um die Insel auftauchte und den Helgoländern eine sprudelnde Einnahmequelle bescherte, wurde sogar das Festland hellhörig: Die friesisch-stämmigen Einwohner mussten sich nun gegen die überfallwütigen Hansestädte wehren, bis die Insel schließlich im Jahre 1490 dem schleswig-holsteinischen Herzog von Gottorp zufiel. Der Herzog nutzte die »Geldquelle Hering« und kassierte Heringszoll, später Remen- und Budengeld, bis circa Mitte des 16. Jahrhunderts der Hering so plötzlich verschwand wie er gekommen - und mit ihm die geschäftstüchtigen Eindringlinge.
Doch ein anderes Volk ließ nicht lange auf sich warten: Der dänische König Christian III. umkämpfte 1544 die Insel mit seinen beiden Brüdern und nahm deät Lun als sein Eigentum in Beschlag.
Nur wenige Jahre später kehrte der Schleswiger Herzog zurück und riss sich »seine Insel« erneut unter den Nagel. Die Gottorp’sche Zeit brach an und sollte bis ins Jahr 1714 dauern.
Im August desselben Jahres erinnerten sich die Dänen daran, dass ihnen die Insel schon einmal gehörte und forderten ihre Rechte ein, indem sie mit ihrer Flotte hinter der Helgoländer Düne vor Anker gingen. Die Einwohner, verschreckt und ängstlich, flohen mitsamt ihren Frauen und Kindern und versteckten sich in den Klippen. Mit Feuermörsern verliehen die Dänen ihrer Forderung Nachdruck. Um Tod und Zerstörung zu beenden, lenkte der helgoländische Kommandant schließlich ein und »bot das Eiland zur Übergabe an«.
Helgoland wurde erneut dänisch, was in der Bevölkerung nicht unbedingt auf Jubel stieß. Man kann sich vorstellen, dass die Insel durch den Beschuss übelst verwüstet worden war. Die dänische Invasion kam den Insulanern teuer zu stehen. Dennoch, das Leben ging weiter. Pragmatisch setzten die Menschen ihr Inselchen wieder instand und fügten sich der übergriffigen Obrigkeit.
Und das sollte sich als vorteilhaft erweisen.
Um 1700 lebten in etwa 1.000 Menschen auf der Insull Hellgeland. Vom 30-jährigen Krieg waren sie verschont geblieben, die rivalisierenden Mächte interessierten sich nicht für die Klippeninsel inmitten der rauschenden Nordsee. Im Gegensatz dazu hatte es die Insel Amrum schlimm erwischt. Hier waren die Schweden eingefallen und hatten verbranntes Land hinterlassen.
Der Kampf der Helgoländer drehte sich um das tägliche Brot. Während der dänischen Zeit veränderte sich das Eiland von Grund auf. Das einfache Fischerdorf verwandelte sich in ein Städtchen. Der Aufschwung unter der Herrschaft der Dänen brachte einen bescheidenen Wohlstand.
Schiffe aus unterschiedlichen Städten, fernen Ländern und exotischen Kolonien steuerten den Helgoländer Hafen an und ließen Handel und Handwerk gedeihen. Die Kriegsflotte der Dänen »Ruhe des Nordens« wachte im Hafen und schützte die Insel durch Neutralität.
Die Helgoländer profitierten vom Aufschwung des Handels. Fortan stellten sie Kapitäne und Steuerleute, die auf Kauffahrteischiffen anheuerten. Sie beteiligten sich mit fähigen Männern am aufkommenden Walfang oder fuhren zum Robbenschlagen ins Nordmeer.
Vorausschauend nutzten die Helgoländer Seeleute ihre Kenntnisse in den tückischen Fahrwassern von Elbe und Weser und stellten Lotsen, die die flachen Sandbänke kannten. Ihre neue Einnahmequelle wussten die Helgoländer gegen fremde Übergriffe zu verteidigen: Fortan betrachteten sie die Gewässer um ihre Insel als gottgegebenes Recht, hier zu fischen, Wracks nebst Ladung zu bergen und Schiffe mit einheimischen Seeleuten zu besetzen. Für dieses Recht kämpften sie - notfalls mit Gewalt.
Aber nun genug Historie. In der nächsten Episode erzähle ich, was wir Helgoländer gern essen und trinken. Anno 1720 versteht sich.
Stürmische Grüße - Gesa
Quellen:
© Sprache Halunder, Projektleiter Prof. Nils Århammar, Projektmitarbeiterin drs. Ritva Århammar
© »Geschichte und Geschichten der Insel Helgoland«, Otto-Erwin Hornsmann, bearbeitet von Erich-Nummel Krüss, Museum Helgoland
© »Helgoland in einer 250 Jahre alten Beschreibung« - Johann Friedrich Camerer (M.-G.Schmitz-Verlag/Nordstrand), Museum Helgoland
Zitate und Eigennamen kursiv
Text ohne KI: © Simone Gütte



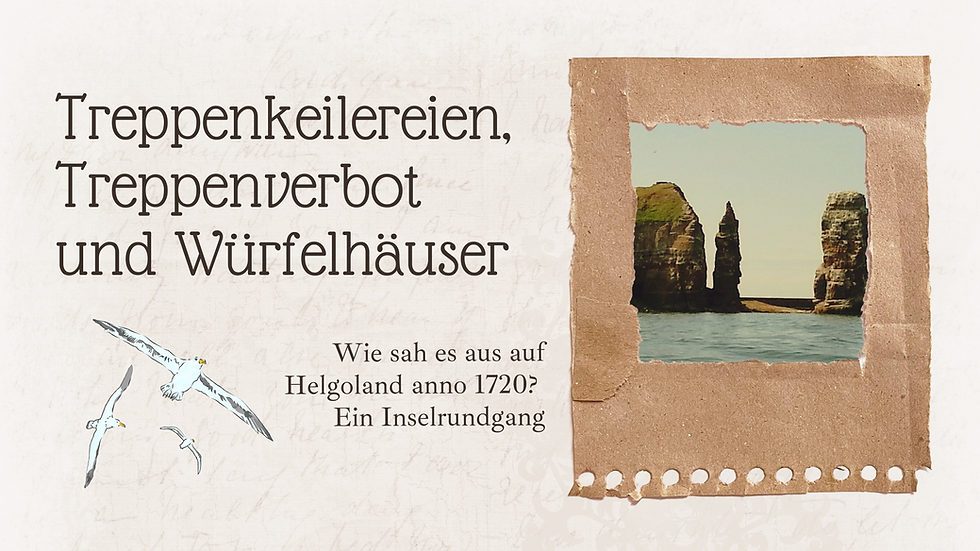


Kommentare