Treppenkeilereien, Treppenverbot und Würfelhäuser
- © Simone Gütte

- 26. Okt.
- 4 Min. Lesezeit
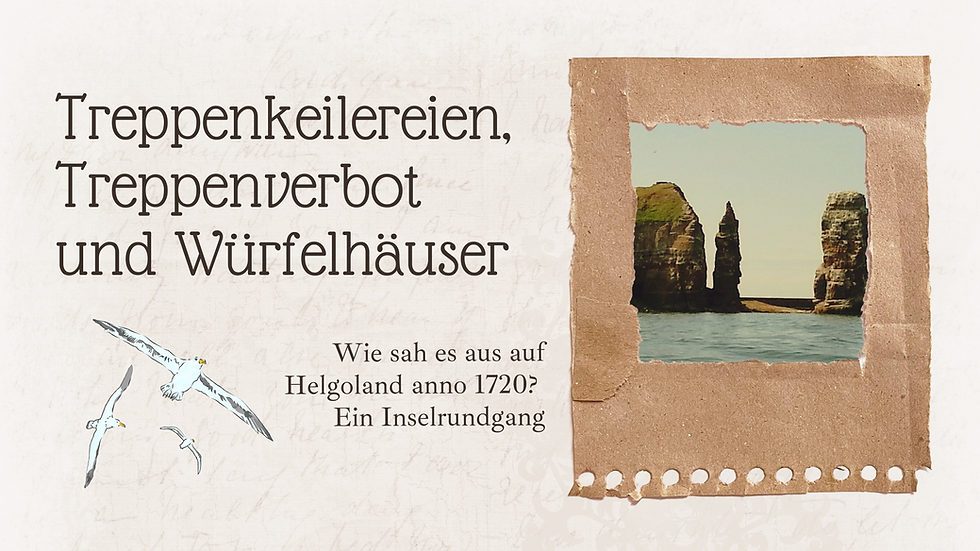
© Foto: Simone Gütte
»Iip ’e Börriger ombiwiite ferbeedʼn!«
»Auf der Treppe ist Herumtollen verboten!« So oder so ähnlich mag der resolute Landvogt, Herr von Colditz, seines Zeichens Soldat alter Schule, die Treppenbesteiger auf deät Lun gemaßregelt haben.
1692 führte vom Oberland von den östlichen Klippen aus gesehen eine hölzerne Treppe mit zwei Abgängen hinab zum Nord- und Südhafen. Am oberen Ende der Treppe befand sich ein Tor mit einer Pforte und das Wachthaus. Diese Treppe zählte circa 180 Stufen, war an einem Mastbaum befestigt und mit Geländern versehen.
Besagter Herr von Colditz stellte fest, dass die Wachhabenden Tag und Nacht von den Trunkenbolden, die aus der Kneipe im Unterland, dem Herrenkrug, hinauf stiefelten, belästigt wurden. Voll mit gutem Husumer Bier beschimpften sie die Wachposten, randalierten oder fingen zu nächtlicher Stunde Treppenkeilereien an.
Von oberhalb ging es nicht sittsamer zu: Die Frauen der dem Alkohol Frönenden holten ihre besseren Hälften aus der Krügerei und taten das mindestens genauso lautstark kund.
Herr von Colditz setzte sich durch und führte ein Treppenverbot ein. Demnach durfte ab sofort weder Männlein noch Weiblein die Treppe bei Nacht betreten. Ausgenommen von der strikten Regel waren alte Leute, die sich nach dem Auf- und Abstieg an den Feuern in den Wachhäuschen wärmen wollten. Beim Glockenläuten wurde das Tor am Wachthaus geschlossen. Mit dieser Maßnahme erreichte der Landvogt immerhin, dass Ruhe einkehrte, was zu nachtschlafender Zeit für alle ein Segen war.
Hatte es der wackere Wanderer die Treppe hinab geschafft, was sowohl tags als auch nachts eine Anstrengung war, stand er mitten in einer Geröllwüste. Hier geht unsereiner nur entlang, wenn keine Sturmwinde wehen. Nur bei starker Ebbe gelangen wir trockenen Fußes um unsere Insel.
Einst war Helgoland viermal so groß wie heute. Mächtige, hohe Steilklippen aus rötlichem und weißen Kalkstein umgaben die Insel. In den Fels im Norden hat die See im Laufe der Gezeiten ein markantes Loch geschlagen. Wir nennen es Pipers Loch, weil es dort wie von Sinnen pfeift.
Schon vor der Sturmflut 1720/21 sah es im Unterland aus, als hätte jemand die Häuser, Fischerbuden und Lagerschuppen wie Würfel über das Land gerollt und dann einfach dort liegen gelassen. Keine geradlinigen Gassen, nur Fußsteige führten durch das Labyrinth der 38 Würfelhäuser, 95 Packhäuser und 100 Fischerbuden. Die Einwohner wohnten in hölzernen oder gemauerten Katen. Zwei Brunnen wurden genutzt, um das Vieh zu tränken. Trink- und Kochwasser daraus zu schöpfen, konnte jedoch üble Magenschmerzen hervorrufen.
Schauen wir die Klippen hinauf. Hier erhebt sich die St. Nicolai-Kirche, gewidmet dem Schutzpatron aller Fischer, Schiffer und Seefahrer, dem heiligen St. Nikolaus. Bereits zwei Vorgänger trotzten hier in den Jahren 1609 und 1686 Sturm und Wetter.
Das obere Land war in vier Quartiere aufgeteilt. Jedes Quartier unterstand einem Quartiermeister. Die circa 400 Häuser waren im Gegensatz zu den Behausungen im Unterland recht gut aufgestellt, die Dächer mit Reet oder Stroh gedeckt, einige sogar mit Pfannen oder Dachziegeln. Durch die Häuserflut führte eine mit Steinen gepflasterte Gasse. Ging der Wanderer gen Norden übers Land, fand er eine weite, grüne Fläche vor, die er gemächlich in einer dreiviertel Stunde umrunden konnte.
Aber Müßiggang war zu keiner Zeit auf Helgoland angesagt.
Das unbebaute Land wurde als Viehweide genutzt. Die 200 Schafe und circa 50 Kühe wurden mit Stricken angepflockt, damit sie nicht von der Klippe wehten. Futter für das Vieh, Holz und Torf besorgten wir vom Festland. Denn das war rar auf Helgoland.
Auf dem Oberland kann man eine Reihe hübsch angelegter Schrebergärten bewundern. Hier werden Kartoffeln, Gemüse, etwas Hafer, aber vor allen Dingen Gerste angebaut. Mit den Gartenfrüchten haben wir Probleme. Sie gedeihen nicht gut aufgrund der beständig salzigen Luft. Bäume verwurzeln sich nicht tief genug in die Erde und werden oft vom Wind mitgerissen. Daher gibt es nur kleinere Bäume wie Apfeldorn und Kirschbäume. Viele Frauen nutzen die windgeschützten Hauswände, um Johannis- und Stachelbeersträucher anzubauen.
Als sturmumtoste Insel mitten in der Nordsee halten wir seit 1630 ein Feuerback (Feuerbake, Leuchtfeuer) vor. Im Nebel, während der Nacht oder bei stürmischen Wetter kommen die Schiffe leicht vom Kurs ab und verunglücken auf den vorgelagerten Riffen, die die ganze Insel umgeben. Das Feuerback wird mit Steinkohle betrieben, ein teures Brenngut, das wir aus Hamburg beziehen. Daher entzündet der Backenmeister nur vom 01. September bis zum 30. April das Leuchtfeuer.
Rund um die Insel tost nicht nur die Nordsee, es wimmelt auch von unterseeischen Riffen und Sandbänken. Im Norden wachsen Mönch und Nonne aus dem Meer, zwei einzigartige Felsgebilde. Eine Tonne auf Reede warnt vor den unsichtbaren Felsenklippen unter Wasser. Nicht selten kommt es vor, dass Schiffe stranden.
Zu guter Letzt möchte ich erwähnen, dass es um 1714 die erste Flagge mit den Farben rot, weiß und grün auf dem Leuchtturm gegeben haben soll.
Wie konnten die Dänen unsere Insel erobern? Das erzähle ich beim nächsten Mal.
Stürmische Grüße - Gesa
Quellen:
© Sprache Halunder, Projektleiter Prof. Nils Århammar, Projektmitarbeiterin drs. Ritva Århammar
© »Schiffsunglücke vor Helgoland 16. bis 20. Jahrhundert«, Max Arnhold, Koehlers Verlagsgesellschaft mbH, Hamburg
© »Geschichte und Geschichten der Insel Helgoland«, Otto-Erwin Hornsmann, bearbeitet von Erich-Nummel Krüss, Museum Helgoland
© »Helgoland in einer 250 Jahre alten Beschreibung« - Johann Friedrich Camerer (M.-G.Schmitz-Verlag/Nordstrand), Museum Helgoland
Zitate und Eigennamen kursiv
Text ohne KI: © Simone Gütte





Kommentare